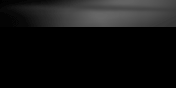

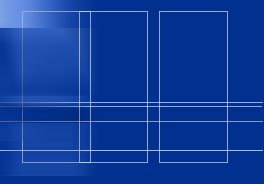
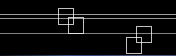
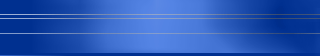

BeamtInnen sind von der Versicherungspflicht in der GKV (Gesetzl. Krankenversicherung) freigestellt (§ 6 Abs. 2 SGB V) und in einem eigenständigen, beamtenspezifischen Krankenversicherungssystem – der Beihilfe – versichert.
Anspruch auf Leistungen der Beihilfe haben auch die Familienmitglieder (berücksichtigungsfähige Angehörige) der Versicherten. Die Beihilfe erfolgt anteilig: 50-80% der Krankheitskosten; keinen Anspruch haben Familienangehörige, die in der GKV versichert sind. Zur Abdeckung der nicht von der Beihilfe erstatteten Kosten kann eine (beihilfekonforme) private Krankenversicherung (zum sogenannten Prozenttarif) abgeschlossen werden.
Es gibt folgende Unterschiede zwischen Beihilfe und GKV in Bezug auf die psychotherapeutische Leistungen:
- keine Kurzzeittherapie
- Behandlungskontingente: weitgehend analog der Psychotherapie-Richtlinien in der GKV
- Probatorische Sitzungen: wie in der PKV(Private Krankenversicherung) bis zu max. 5 Sitzungen
- Die Abrechnung von Seiten der Psychotherapeutin erfolgt wie in der PKV durch Rechnungsstellung (GOÄ/GOP: Gebührenordnung für Ärzte/ Psychotherapeuten) an den Patienten
Psychotherapie ist Bestandteil des Leistungskataloges der Beihilfe. Die Verhaltenstherapie ist ein von der Beihilfe anerkanntes Therapieverfahren. Die Kostenübernahme durch die Beihilfe von Bund und Ländern (Beamtenversorgung) geschieht in der Regel problemlos. Eine übliche Psychotherapie hat bei der Beihilfe einen Umfang von 40 Sitzungen. Die Kosten einer notwendigen psychotherapeutischen Behandlung werden unter den im Folgenden beschriebenen Voraussetzungen von der Beihilfe übernommen. Die folgenden Hinweise beziehen sich auf Einzeltherapie bei Erwachsenen:
Beihilfeberechtigte können eine psychotherapeutische Praxis direkt aufsuchen (Erstzugangsrecht). Ein vorheriger Arztbesuch oder eine Überweisung sind nicht notwendig. Sie müssen aber Ihre Absicht, eine Psychotherapie zu beginnen, VOR dem ersten Termin in meiner Praxis der Beihilfestelle mitteilen und meinen Namen und die Praxisadresse angeben.
Zu Beginn der Behandlung finden zunächst bis zu fünf diagnostische Sitzungen (probatorische Sitzungen) statt. In diesen Sitzungen wird von Patient und Therapeut geprüft, ob sie eine gute, tragfähige und vertrauensvolle therapeutische Beziehung entwickeln können. Soll eine Psychotherapie beantragt werden, ist eine Bescheinigung des behandelnden Haus- oder Facharztes über den körperlichen Befund (Konsiliarbericht) erforderlich. Dies ist sinnvoll, um einerseits eine körperliche Ursache der Probleme klar ausschließen zu können und andererseits mögliche körperliche Erkrankungen mit in der Therapie berücksichtigen zu können. Danach kann die Kostenübernahme für die Psychotherapie bei der Beihilfe beantragt werden. Bei der Antragstellung bin ich gerne behilflich.
Beihilfeberechtigte Patienten haben in der Regel eine zusätzliche private Krankenversicherung abgeschlossen. Bei einer psychotherapeutischen Behandlung schließt sich die jeweilige private Krankenversicherung meist der Befürwortung der Therapie durch die Beihilfestelle an und übernimmt den vertraglich vereinbarten Kostenanteil. Es ist dennoch immer sinnvoll, in den Versicherungsbedingungen der privaten Krankenversicherung nachzusehen, ob und unter welchen Voraussetzungen die anteiligen Kosten übernommen werden.
Wenden Sie sich an Ihre Beihilfestelle. Diese sendet Ihnen auf Anfrage die Unterlagen zur Antragstellung zu, die Sie sich am besten bereits schicken lassen, bevor Sie zur ersten Probesitzung gehen. Nach den 5 Probesitzungen schreibe ich einen Bericht an den Gutachter der Beihilfe. Niemals schließt sich die Beihilfe dem Verfahren Ihrer Versicherung an, zuerst kommt das Verfahren der Beihilfe. Die meisten Versicherungen schließen sich der Entscheidung der Beihilfestelle an.
Achtung: Sowohl Beihilfe als auch private Versicherungen erstatten erst, nachdem sie schriftlich genehmigt haben - und zwar erst ab dem Zeitpunkt der Genehmigung! Die Probesitzungen sind davon ausgenommen.